
- Home
- Blog
- Datenschutz & Sicherheit
- Telemedizin Datenschutz: So schützen Sie Ihre Gesundheitsdaten bei Video-Sprechstunden
Telemedizin Datenschutz: So schützen Sie Ihre Gesundheitsdaten bei Video-Sprechstunden
Hinweis: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wenn Sie über diese Links einkaufen, erhalten wir eine kleine Provision. Für Sie entstehen keine zusätzlichen Kosten.
Gesundheitsdaten gehören zu den sensibelsten persönlichen Informationen. Wenn Sie eine Video-Sprechstunde nutzen, teilen Sie intime Details über Ihren Körper und Ihre Beschwerden – digital und über das Internet. Die entscheidende Frage lautet: Wie sicher sind Ihre Daten wirklich?
In diesem umfassenden Ratgeber erfahren Sie alles über Datenschutz in der Telemedizin: rechtliche Grundlagen, technische Sicherheitsmaßnahmen, wie Sie sichere Anbieter erkennen und welche Rechte Sie haben. Fundiert, verständlich und ohne technisches Fachchinesisch.
Rechtliche Grundlagen: DSGVO, ärztliche Schweigepflicht und eHealth-Gesetze
Telemedizin-Anbieter unterliegen in Deutschland einem der strengsten Datenschutzrahmen weltweit. Gleich mehrere Gesetze und Verordnungen schützen Ihre Gesundheitsdaten.
Die DSGVO: Europas Datenschutz-Schild
Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist seit Mai 2018 in der gesamten EU gültig und bildet das Fundament des digitalen Datenschutzes. Für Gesundheitsdaten gelten dabei besonders strenge Regelungen.
Wichtigste Prinzipien für Telemedizin:
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung: Ihre Gesundheitsdaten dürfen nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung verarbeitet werden. Diese Einwilligung muss freiwillig, informiert und jederzeit widerrufbar sein.
Zweckbindung: Daten dürfen nur für den vereinbarten Zweck verwendet werden – also für Ihre medizinische Behandlung. Eine Weitergabe an Dritte (z.B. für Werbung) ist ohne neue Einwilligung verboten.
Datenminimierung: Plattformen dürfen nur die Daten erheben, die für die Behandlung wirklich notwendig sind. Überflüssige Datenabfragen sind unzulässig.
Speicherbegrenzung: Gesundheitsdaten müssen nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gelöscht werden (in der Regel 10 Jahre nach Behandlungsende).
Sicherheit der Verarbeitung: Anbieter müssen technische und organisatorische Maßnahmen treffen, um Datenschutzverletzungen zu verhindern.
Bei Verstößen drohen Bußgelder von bis zu 20 Millionen Euro oder 4% des weltweiten Jahresumsatzes – ein starker Anreiz für Compliance.
Ärztliche Schweigepflicht: Auch digital gültig
Die ärztliche Schweigepflicht nach § 203 StGB gilt uneingeschränkt auch für Telemedizin. Ärzte machen sich strafbar, wenn sie Patientengeheimnisse unbefugt offenbaren – unabhängig davon, ob die Behandlung persönlich oder digital erfolgt.
Konkret bedeutet das:
- Ihr Telemedizin-Arzt darf keine Informationen über Sie weitergeben
- Auch gegenüber Angehörigen gilt die Schweigepflicht (es sei denn, Sie entbinden ihn davon)
- Die Plattform muss technisch sicherstellen, dass Unbefugte keinen Zugriff haben
- Verstöße können mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe geahndet werden
Patientendaten-Schutz-Gesetz und E-Health-Gesetze
Deutschland hat zusätzlich spezifische Gesetze für digitale Gesundheit erlassen:
Patientendaten-Schutz-Gesetz (PDSG):
- Regelt den Umgang mit der elektronischen Patientenakte (ePA)
- Verschärft Anforderungen an IT-Sicherheit im Gesundheitswesen
- Gibt Patienten mehr Kontrolle über ihre Daten
Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG):
- Schafft rechtliche Grundlagen für Apps auf Rezept (DiGA)
- Definiert Sicherheits- und Qualitätsstandards für digitale Gesundheitsanwendungen
- Stärkt Patientenrechte bei digitalen Angeboten
Die Kernbotschaft: Telemedizin-Datenschutz ist gesetzlich umfassend geregelt und Verstöße haben ernste Konsequenzen.
Technische Sicherheitsmaßnahmen: Wie Ihre Daten geschützt werden
Gesetze sind das eine – technische Umsetzung das andere. Seriöse Telemedizin-Plattformen nutzen mehrschichtige Sicherheitskonzepte.
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung: Das Herzstück der Sicherheit
Was bedeutet Ende-zu-Ende-Verschlüsselung?
Bei einer Video-Sprechstunde mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung werden Ihre Daten direkt auf Ihrem Gerät verschlüsselt, bevor sie über das Internet gesendet werden. Erst auf dem Gerät des Arztes werden sie wieder entschlüsselt.
Der Vorteil: Selbst wenn jemand die Daten während der Übertragung abfangen würde (z.B. beim Zugriff über öffentliches WLAN), könnte er damit nichts anfangen – die Daten wären unleserlicher Kauderwelsch.
Wichtig zu verstehen: Auch der Plattform-Betreiber hat bei echter Ende-zu-Ende-Verschlüsselung keinen Zugriff auf Ihre Gesprächsinhalte. Nur Sie und Ihr Arzt können die Kommunikation entschlüsseln.
Technische Standards:
- TLS 1.3: Verschlüsselung der Datenübertragung (Transport Layer Security)
- AES-256: Verschlüsselung der gespeicherten Daten (Advanced Encryption Standard)
- WebRTC mit DTLS-SRTP: Verschlüsselte Video- und Audiokommunikation
Diese Standards gelten als unknackbar mit aktuell verfügbarer Technologie.
Sichere Datenspeicherung: Wo liegen Ihre Daten?
Serverstandorte sind entscheidend:
Seriöse deutsche Anbieter speichern Gesundheitsdaten ausschließlich auf Servern in Deutschland oder der EU. Warum ist das wichtig?
- Rechtsschutz: EU-Datenschutzrecht gilt uneingeschränkt
- Zugriffskontrolle: Keine Zugriffsmöglichkeit durch Behörden aus Drittstaaten (z.B. USA)
- Rechtsdurchsetzung: Bei Verstößen können Sie in Deutschland klagen
Warnsignal: Anbieter mit Servern in den USA oder anderen Drittstaaten unterliegen oft lockereren Datenschutzbestimmungen. Der sogenannte “Cloud Act” erlaubt US-Behörden unter Umständen Zugriff auf Daten – auch wenn diese von EU-Bürgern stammen.
Fragen Sie nach:
- Wo genau stehen die Server? (Stadt/Land)
- Gibt es Backups? Wo werden diese gespeichert?
- Nutzt der Anbieter Cloud-Dienste? Von wem (AWS, Microsoft, Google)?
Zugriffskontrollen und Authentifizierung
Wer kann Ihre Daten sehen?
Strenge Zugriffskontrollen stellen sicher, dass nur autorisierte Personen auf Patientendaten zugreifen können.
Mehrstufige Authentifizierung:
- Für Patienten: Passwort + SMS-Code oder biometrische Verifikation (Fingerabdruck, Face-ID)
- Für Ärzte: Starke Authentifizierung plus elektronischer Heilberufsausweis (eHBA)
- Für Admins: Höchste Sicherheitsstufe mit Protokollierung aller Zugriffe
Berechtigungskonzept:
- Nur der behandelnde Arzt darf auf Ihre Akte zugreifen
- Technisches Personal hat keinen Zugriff auf medizinische Inhalte
- Alle Zugriffe werden dokumentiert (Audit-Logs)
- Regelmäßige Überprüfung der Zugriffsrechte
Best Practice: Nutzen Sie für Ihr Telemedizin-Konto ein einzigartiges, starkes Passwort und aktivieren Sie Zwei-Faktor-Authentifizierung, wenn verfügbar.
Regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen und Zertifizierungen
Seriöse Anbieter lassen ihre IT-Sicherheit regelmäßig von externen Experten prüfen.
Wichtige Zertifizierungen:
ISO 27001 (Informationssicherheit): Internationaler Standard für Informationssicherheits-Managementsysteme. Anbieter mit dieser Zertifizierung haben nachweislich umfassende Sicherheitsprozesse implementiert.
CE-Kennzeichnung als Medizinprodukt: Telemedizin-Plattformen gelten als Medizinprodukte und müssen entsprechend zertifiziert sein. Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllt sind.
Penetrationstests: Ethische Hacker versuchen, in das System einzudringen, um Schwachstellen zu identifizieren, bevor echte Angreifer sie ausnutzen können.
BSI-Grundschutz: Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bietet Standards für IT-Sicherheit. Anbieter, die diese umsetzen, erfüllen staatliche Sicherheitsanforderungen.
Fragen Sie nach Zertifikaten – seriöse Anbieter veröffentlichen diese auf ihrer Website oder senden sie auf Anfrage zu.
Serverstandorte und internationale Anbieter: Was Sie wissen müssen
Die Globalisierung macht auch vor der Telemedizin nicht halt. Doch internationale Anbieter bringen datenschutzrechtliche Herausforderungen mit sich.
Deutsche vs. internationale Telemedizin-Plattformen
Deutsche/EU-Anbieter:
Vorteile:
- Volle DSGVO-Konformität garantiert
- Server in Deutschland/EU
- Deutsche Datenschutzbehörden zuständig
- Ärztliche Schweigepflicht nach deutschem Recht
- Einfache Rechtsdurchsetzung bei Problemen
Beispiele: TeleClinic, KRY, Barmer Teledoktor, TK-Doc
Internationale Anbieter (z.B. aus USA, UK):
Risiken:
- Möglicherweise Server außerhalb der EU
- Zugriffsmöglichkeiten ausländischer Behörden
- Unterschiedliche Datenschutzstandards
- Komplizierte Rechtsdurchsetzung
- Sprachbarrieren in Datenschutzerklärungen
Ausnahmen: Manche internationale Anbieter betreiben für EU-Kunden separate Server in der EU und erfüllen DSGVO-Anforderungen vollständig.
Datentransfer in Drittstaaten: Wann wird es problematisch?
Der Schrems-II-Beschluss des EuGH (2020):
Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass Datentransfers in die USA problematisch sind, da US-Überwachungsgesetze mit EU-Datenschutz unvereinbar sind.
Konkrete Folgen für Sie:
- Anbieter mit US-Servern müssen zusätzliche Garantien bieten
- “Privacy Shield” (alte Rechtsgrundlage) ist ungültig
- Standardvertragsklauseln allein reichen oft nicht aus
- Datentransfers müssen im Einzelfall geprüft werden
Empfehlung: Bevorzugen Sie Anbieter, die Daten ausschließlich in Deutschland oder der EU verarbeiten. Das vermeidet rechtliche Grauzonen und gibt Ihnen maximale Rechtssicherheit.
Checkliste: Serverstandort prüfen
So finden Sie heraus, wo Ihre Daten gespeichert werden:
- Datenschutzerklärung lesen: Suchen Sie nach “Serverstandort”, “Datenspeicherung” oder “Hosting”
- Impressum prüfen: Wo sitzt der Anbieter? (Gibt Hinweise auf Rechtsraum)
- Support fragen: Stellen Sie konkrete Fragen zum Serverstandort
- Technische Analyse: Fortgeschrittene können DNS-Lookups durchführen
Rote Flaggen:
- Keine Angaben zum Serverstandort in der Datenschutzerklärung
- Ausweichende Antworten vom Support
- Server in Ländern mit schwachem Datenschutz (z.B. USA, China, Russland)
- Cloud-Dienste ohne EU-Garantien
So erkennen Sie sichere Telemedizin-Anbieter: Der Sicherheits-Check
Nicht alle Anbieter halten, was sie versprechen. Mit dieser Checkliste identifizieren Sie vertrauenswürdige Plattformen. Einen umfassenden Vergleich der besten Telemedizin-Anbieter finden Sie in unserem detaillierten Anbieter-Test.
Die 10-Punkte-Datenschutz-Checkliste
1. Transparente Datenschutzerklärung:
- In deutscher Sprache verfügbar
- Verständlich formuliert (kein Juristendeutsch)
- Konkrete Angaben zu Datenverarbeitung
- Leicht auffindbar (nicht versteckt im Impressum)
2. CE-Kennzeichnung als Medizinprodukt:
- Sichtbar auf der Website angebracht
- Mit Kennnummer der benannten Stelle
- Zeigt: Plattform erfüllt medizintechnische Standards
3. ISO 27001-Zertifizierung:
- Nachweis eines Informationssicherheits-Managementsystems
- Regelmäßige externe Audits
- Öffentlich einsehbares Zertifikat
4. Serverstandort Deutschland/EU:
- Explizit in Datenschutzerklärung genannt
- Keine Datentransfers in Drittstaaten
- Backup-Server ebenfalls in EU
5. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung:
- Für Video-Sprechstunden explizit angegeben
- Verwendete Standards genannt (TLS 1.3, AES-256)
- Verschlüsselung nicht nur für Übertragung, sondern auch Speicherung
6. Zwei-Faktor-Authentifizierung:
- Zusätzliche Sicherheitsebene beim Login
- Per SMS, App oder biometrisch
- Schutz vor unbefugtem Zugriff
7. Datenschutzbeauftragter benannt:
- Kontaktdaten öffentlich verfügbar
- Ansprechpartner für Datenschutzfragen
- DSGVO-Pflicht für Gesundheitsdienstleister
8. Mitgliedschaft in Fachverbänden:
- Z.B. Bundesverband Internetmedizin e.V.
- Zeigt: Anbieter unterwirft sich Branchenstandards
- Qualitätssigel und ethische Guidelines
9. Kassenärztliche Zulassung der Ärzte:
- Alle Ärzte in Deutschland approbiert
- Kassenärztliche Vereinigung prüft Qualifikation
- Unterliegen deutscher Schweigepflicht
10. Positive Bewertungen zu Datenschutz:
- Nutzererfahrungen lesen
- Prüfen, ob Datenschutzverletzungen bekannt wurden
- Bewertungen auf unabhängigen Plattformen
Wenn mindestens 8 von 10 Punkten erfüllt sind, können Sie dem Anbieter vertrauen.
Warnsignale: Wann Sie skeptisch werden sollten
Absolute No-Gos:
- Keine Datenschutzerklärung vorhanden
- Anbieter sitzt außerhalb der EU ohne EU-Niederlassung
- Keine Angaben zur Verschlüsselung
- Werbung mit Patientendaten (zeigt Missachtung der Privatsphäre)
- Bekannte Datenschutzverletzungen in der Vergangenheit
Bedenkliche Anzeichen:
- Sehr günstige Preise (Geschäftsmodell könnte Datenverkauf sein)
- Übermäßig viele Berechtigungsanfragen der App (z.B. Standort, Kontakte)
- Intransparente Geschäftsbedingungen
- Fehlende Zertifizierungen trotz langer Marktpräsenz
- Negative Datenschutz-Bewertungen von Experten
Im Zweifelsfall: Fragen Sie direkt beim Anbieter nach oder wenden Sie sich an Verbraucherschutzorganisationen.
Ihre Rechte als Patient: Was Sie verlangen können
Die DSGVO gibt Ihnen umfassende Rechte über Ihre Gesundheitsdaten. Kennen und nutzen Sie diese.
Auskunftsrecht: Was weiß der Anbieter über mich?
Artikel 15 DSGVO – Recht auf Auskunft:
Sie können jederzeit verlangen zu erfahren:
- Welche personenbezogenen Daten gespeichert sind
- Zu welchem Zweck diese Daten verarbeitet werden
- An wen die Daten weitergegeben wurden
- Wie lange die Daten gespeichert werden
- Woher die Daten stammen
Wie Sie Ihr Auskunftsrecht ausüben:
- Schriftliche Anfrage an den Datenschutzbeauftragten des Anbieters
- Anbieter muss innerhalb von 4 Wochen (maximal 3 Monate) antworten
- Auskunft ist kostenlos
- Sie erhalten eine Kopie aller gespeicherten Daten
Praktischer Nutzen: Sie sehen genau, welche Informationen über Ihre Gesundheit gespeichert sind und können Fehler identifizieren.
Recht auf Berichtigung und Löschung
Artikel 16 DSGVO – Berichtigung:
Falsche oder unvollständige Daten müssen auf Ihren Antrag korrigiert werden. Dies ist besonders wichtig bei:
- Fehlerhaften Diagnosen in der Akte
- Veralteten Medikationslisten
- Falschen Kontaktdaten
Artikel 17 DSGVO – Recht auf Vergessenwerden:
Sie können die Löschung Ihrer Daten verlangen, wenn:
- Die Daten nicht mehr für den ursprünglichen Zweck benötigt werden
- Sie Ihre Einwilligung widerrufen (und keine andere Rechtsgrundlage besteht)
- Die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden
Wichtige Einschränkung: Ärzte müssen Patientenakten 10 Jahre aufbewahren (gesetzliche Aufbewahrungspflicht). Danach müssen die Daten gelöscht werden.
Löschung beantragen:
- Schriftliche Anfrage an den Anbieter
- Anbieter muss innerhalb eines Monats reagieren
- Bei Ablehnung: Begründung erforderlich
- Sie können sich an Datenschutzbehörde wenden
Recht auf Datenübertragbarkeit
Artikel 20 DSGVO – Datenportabilität:
Sie können verlangen, dass Ihre Daten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format (z.B. PDF, CSV) bereitgestellt werden. Zudem können Sie verlangen, dass die Daten direkt an einen anderen Anbieter übermittelt werden.
Praktischer Nutzen:
- Anbieterwechsel wird einfacher
- Sie behalten Kontrolle über Ihre Gesundheitsdaten
- Keine Vendor-Lock-in-Effekte
Beispiel: Sie wechseln von TeleClinic zu KRY und möchten Ihre Behandlungshistorie mitnehmen. Der alte Anbieter muss Ihre Daten in einem übertragbaren Format bereitstellen.
Widerspruchsrecht und Einwilligungswiderruf
Artikel 21 DSGVO – Widerspruchsrecht:
Sie können der Datenverarbeitung jederzeit widersprechen, wenn:
- Die Verarbeitung auf berechtigtem Interesse des Anbieters beruht
- Ihre Interessen die des Anbieters überwiegen
Einwilligung widerrufen:
Wenn Sie ursprünglich in die Datenverarbeitung eingewilligt haben, können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf wirkt für die Zukunft, bereits erfolgte Verarbeitung bleibt rechtmäßig.
Folge des Widerrufs: Der Anbieter muss die Datenverarbeitung einstellen (außer es gibt andere Rechtsgrundlagen wie die ärztliche Aufbewahrungspflicht).
Beschwerderecht bei der Datenschutzbehörde
Artikel 77 DSGVO – Beschwerderecht:
Wenn Sie glauben, dass Ihre Datenschutzrechte verletzt wurden, können Sie sich an die zuständige Datenschutzbehörde wenden:
In Deutschland:
- Landesbeauftragte für Datenschutz (je nach Bundesland)
- Bundesdatenschutzbeauftragte (bei Bundesbehörden)
Beschwerde ist kostenlos und kann formlos eingereicht werden. Die Behörde prüft den Fall und leitet gegebenenfalls Maßnahmen ein.
Zusätzlich: Sie können zivilrechtlich gegen den Anbieter vorgehen und Schadensersatz fordern, wenn Ihnen durch Datenschutzverstöße ein Schaden entstanden ist.
Häufige Datenschutz-Mythen aufgeklärt
Rund um Telemedizin-Datenschutz kursieren viele Missverständnisse. Wir klären auf.
Mythos 1: “Die Krankenkasse sieht alles”
Falsch. Ihre Krankenkasse erhält nur Abrechnungsinformationen:
- Datum der Konsultation
- Art der Leistung (z.B. “Video-Sprechstunde”)
- Abgerechnete Kosten
Sie erhält nicht:
- Diagnosen (außer für spezielle Abrechnungszwecke in anonymisierter Form)
- Gesprächsinhalte
- Verschriebene Medikamente (außer bei Rezepteinlösung)
Die ärztliche Schweigepflicht gilt auch gegenüber Krankenkassen.
Mythos 2: “Video-Sprechstunden können abgehört werden”
Extrem unwahrscheinlich. Bei Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist das Abhören praktisch unmöglich. Selbst wenn jemand die Datenübertragung abfängt, erhält er nur verschlüsselte, unleserliche Daten.
Reale Risiken sind eher:
- Unsichere WLAN-Netzwerke (nutzen Sie Ihr eigenes oder mobile Daten)
- Schadsoftware auf Ihrem Gerät (halten Sie Ihr Betriebssystem aktuell)
- Lauschende Personen im selben Raum (sorgen Sie für Privatsphäre)
Mythos 3: “Apps verkaufen meine Gesundheitsdaten”
Nicht bei seriösen Anbietern. In der EU ist der Verkauf von Gesundheitsdaten ohne Einwilligung illegal und wird mit hohen Strafen geahndet.
Unterscheiden Sie:
- Telemedizin-Plattformen: Unterliegen strengsten Datenschutzregeln, dürfen Daten nicht verkaufen
- Fitness-Apps: Oft weniger reguliert, manche verkaufen anonymisierte Daten
- Lifestyle-Apps: Können teilweise Daten zu Werbezwecken nutzen
Tipp: Lesen Sie die Datenschutzerklärung – seriöse Anbieter schließen Datenverkauf explizit aus.
Mythos 4: “Gelöschte Daten sind nicht wirklich weg”
Kommt darauf an. Bei seriösen Anbietern mit zertifizierten Löschprozessen werden Daten unwiederbringlich entfernt.
Sichere Löschung bedeutet:
- Daten werden nicht nur als “gelöscht” markiert
- Speicherbereiche werden überschrieben
- Backups werden ebenfalls bereinigt
- Wiederherstellung ist technisch unmöglich
Fragen Sie nach: “Wie stellen Sie sichere Löschung nach DSGVO-Standard sicher?”
Mythos 5: “Ausländische Anbieter sind unsicher”
Pauschal falsch. Entscheidend ist nicht die Nationalität, sondern:
- Einhaltung der DSGVO
- Serverstandorte in der EU
- Zertifizierungen und Standards
Manche internationale Anbieter erfüllen höhere Sicherheitsstandards als deutsche Anbieter. Entscheidend ist die individuelle Prüfung.
Praktische Tipps: So schützen Sie Ihre Daten zusätzlich
Neben der Anbieterwahl können Sie selbst viel für Ihre Datensicherheit tun.
Starke Passwörter und Zwei-Faktor-Authentifizierung
Passwort-Best-Practices:
- Mindestens 12 Zeichen (besser 16+)
- Mix aus Groß-/Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen
- Keine Wörter aus dem Wörterbuch
- Einzigartig für jede Plattform
- Nutzen Sie einen Passwort-Manager (z.B. Bitwarden, 1Password)
Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren:
- Zusätzliche Sicherheitsebene beim Login
- Selbst bei Passwortdiebstahl ist Zugriff erschwert
- Nutzen Sie Authenticator-Apps statt SMS (sicherer)
Passwort ändern, wenn:
- Sie Verdacht auf Kompromittierung haben
- Ein Datenleck beim Anbieter bekannt wird
- Sie ein schwaches Passwort verwendet haben
- Alle 6-12 Monate (Vorsichtsmaßnahme)
Sichere WLAN-Verbindungen nutzen
Nie über öffentliches WLAN: Vermeiden Sie Video-Sprechstunden in Cafés, Flughäfen oder Hotels. Öffentliche Netzwerke sind oft ungesichert und ermöglichen Angriffe.
Empfohlene Verbindungen:
- Heimnetzwerk: Sichern Sie Ihr WLAN mit WPA3-Verschlüsselung und starkem Passwort
- Mobile Daten: Nutzen Sie 4G/5G für unterwegs (sicherer als öffentliches WLAN)
- VPN: Virtual Private Network verschlüsselt zusätzlich (gut bei unsicheren Netzen)
WLAN-Sicherheit prüfen:
- Router-Firmware aktuell halten
- Standard-Admin-Passwort des Routers ändern
- Gastnetzwerke für Besucher einrichten
- MAC-Filterung aktivieren (fortgeschritten)
Geräte-Sicherheit: Smartphone, Tablet, PC
Betriebssystem aktuell halten: Updates schließen Sicherheitslücken. Aktivieren Sie automatische Updates auf allen Geräten.
Virenschutz installieren: Auch auf Smartphones (Android) sinnvoll. Nutzen Sie renommierte Anbieter wie Kaspersky, Norton oder kostenlose Lösungen wie Avast.
Geräte-Verschlüsselung aktivieren: Moderne Smartphones und PCs bieten Vollverschlüsselung. Bei Verlust sind Ihre Daten geschützt.
Bildschirmsperre: PIN, Passwort oder biometrische Sperre (Fingerabdruck, Face-ID) verhindern unbefugten Zugriff.
Apps nur aus offiziellen Stores: Laden Sie Telemedizin-Apps nur aus Google Play Store oder Apple App Store – nie von Drittanbieter-Websites.
Daten sparsam angeben
Prinzip der Datenminimierung: Geben Sie nur Informationen an, die für Ihre Behandlung wirklich notwendig sind.
Überdenken Sie Angaben zu:
- Optionalen Feldern im Registrierungsformular
- Fitness-Tracking-Integrationen
- Social-Media-Verknüpfungen
- Standortfreigaben
Fragen Sie sich: Braucht der Arzt diese Information wirklich für meine Behandlung?
Regelmäßige Überprüfung Ihrer Daten
Mindestens einmal jährlich:
- Loggen Sie sich ein und prüfen Sie gespeicherte Daten
- Löschen Sie alte, nicht mehr benötigte Informationen
- Aktualisieren Sie Kontaktdaten
- Prüfen Sie Zugriffsberechtigungen (wer hat auf Ihre Daten zugegriffen?)
Bei Anbieterwechsel:
- Fordern Sie Löschung beim alten Anbieter an
- Nutzen Sie Datenportabilität, um Daten mitzunehmen
- Prüfen Sie, ob Löschung wirklich erfolgt ist (Auskunftsrecht)
Fazit: Telemedizin kann sicher sein – wenn Sie wissen, worauf es ankommt
Gesundheitsdaten in der Telemedizin können sehr sicher sein – vorausgesetzt, Sie wählen den richtigen Anbieter und beachten grundlegende Sicherheitsregeln.
Die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst
Rechtlicher Schutz ist stark: DSGVO, ärztliche Schweigepflicht und spezielle eHealth-Gesetze bieten umfassenden Rechtsschutz. Verstöße werden mit hohen Strafen geahndet.
Technische Sicherheit ist machbar: Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, sichere Serverstandorte und Zugriffskontrollen machen Ihre Daten nahezu unknackbar – bei seriösen Anbietern.
Ihre Rechte sind umfassend: Auskunft, Berichtigung, Löschung, Datenübertragbarkeit – Sie haben die Kontrolle über Ihre Daten.
Eigenverantwortung ist wichtig: Starke Passwörter, sichere Verbindungen und sparsame Datenangabe erhöhen Ihre Sicherheit zusätzlich.
Ihre Datenschutz-Checkliste für Telemedizin
Bevor Sie einen Anbieter nutzen:
- ✅ Datenschutzerklärung gelesen und verstanden
- ✅ CE-Kennzeichnung und ISO 27001-Zertifikat vorhanden
- ✅ Serverstandort in Deutschland/EU bestätigt
- ✅ Ende-zu-Ende-Verschlüsselung garantiert
- ✅ Positive Bewertungen zu Datenschutz gefunden
- ✅ Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert
- ✅ Starkes, einzigartiges Passwort erstellt
- ✅ Sichere Internetverbindung sichergestellt
Wenn alle Punkte erfüllt sind, können Sie Telemedizin mit gutem Gewissen nutzen.
Ausblick: Die Zukunft des Datenschutzes in der Telemedizin
Positive Entwicklungen:
- Immer strengere Zertifizierungsstandards
- Wachsendes Bewusstsein der Anbieter für Datenschutz
- Technologische Fortschritte (z.B. Blockchain für unveränderbare Behandlungshistorie)
- Europäische Gesundheitsdatenräume für sichere grenzüberschreitende Behandlung
Herausforderungen bleiben:
- Balance zwischen Datenschutz und medizinischer Innovation
- Internationale Anbieter und Datentransfers
- Neue Technologien wie KI-Diagnostik und ihre Datenschutzimplikationen
- Wachsende Datenmengen und Angriffsoberflächen
Die gute Nachricht: Datenschutz in der Telemedizin wird tendenziell besser, nicht schlechter. Gesetzgeber, Anbieter und Datenschutzbehörden arbeiten kontinuierlich an Verbesserungen.
Ihre Gesundheit und Ihre Privatsphäre müssen keine Gegensätze sein. Mit Wissen und bewussten Entscheidungen können Sie die Vorteile der Telemedizin sicher nutzen. Bleiben Sie informiert, stellen Sie Fragen und fordern Sie Transparenz ein – Ihre Daten sind es wert.
Themen:
Ähnliche Artikel
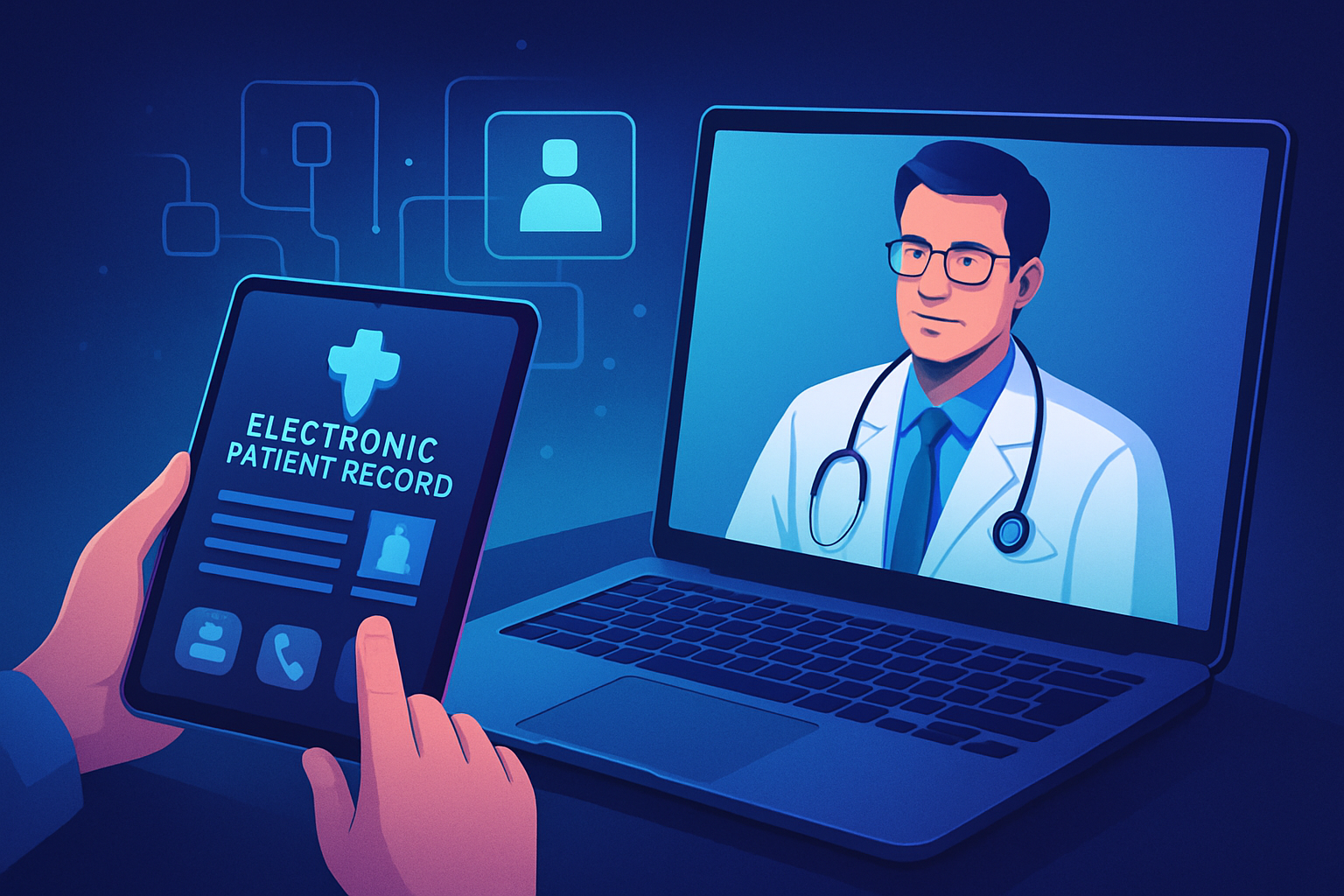
Elektronische Patientenakte und Telemedizin – So arbeiten ePA und Online-Arztbesuch zusammen
Wie elektronische Patientenakte (ePA) und Telemedizin zusammenwirken: Vorteile, Funktionen und praktische Tipps zur Nutzung der digitalen Gesundheitsakte bei Video-Sprechstunden.

Telemedizin für Senioren: Online-Arztbesuch im Alter leicht gemacht
Telemedizin für Senioren erklärt: Wie auch ältere Menschen von Video-Sprechstunden profitieren, technische Hürden meistern und medizinische Versorgung von zuhause erhalten.

Telemedizin Anbieter Vergleich 2025 – Die besten Online-Arzt Plattformen
Welcher Telemedizin-Anbieter passt zu Ihnen? Unser detaillierter Vergleich zeigt die besten Plattformen für Video-Sprechstunden, Online-Rezepte und digitale Gesundheitsversorgung.